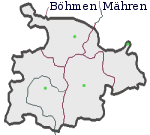Runarz
| Erste Erwähnung: | 1553 |
| Einwohner 1939: | 612 |
| Fläche: | 379 ha |
| Landkreis: | Mährisch Trübau |
| tschech. Name: | Runarov |
| besondere Lage: | Sprachinsel Deutsch-Brodek/Wachtl |
Verweise
 Erstmals erwähnt findet sich Runarz 1351, als der Herr Jesco von Konitz nicht nur alle seine
Besitztümer im Städtchen Konitz - einschließlich der dortigen Feste -, sondern auch das Dorf
Runarzow samt Mühlen und Fischteichen seiner Gemahlin Caecilia zuschreibt
[JB-01, S. 28].
Runarz teilte über Jahrhunderte die Geschicke des Schönhengstgaues. Bauerntum und später
die Weberei bestimmten das Leben.
Erstmals erwähnt findet sich Runarz 1351, als der Herr Jesco von Konitz nicht nur alle seine
Besitztümer im Städtchen Konitz - einschließlich der dortigen Feste -, sondern auch das Dorf
Runarzow samt Mühlen und Fischteichen seiner Gemahlin Caecilia zuschreibt
[JB-01, S. 28].
Runarz teilte über Jahrhunderte die Geschicke des Schönhengstgaues. Bauerntum und später
die Weberei bestimmten das Leben.
 Georg Tilscher erzählt realistisch vom Runarz zu Ende des 19. Jahrhunderts: "Auch im
Zeitalter der Industrialisierung ging in Runarz noch lange das Leben in der althergebrachten
Weise weiter. Der allgemeine Fortschritt bahnte sich nur langsam an. Im Landbau
verschwanden die Brachen und verminderte sich die Zahl der Flachsfelder. Der Siegeszug der
Baumwolle verdrängte langsam den Lein und förderte die Hausweberei. In den 70er und 80er
Jahren wurde fast in allen Häuschen, im Winter auch in Bauernhäusern, gewebert. Wo es der
Raum gestattete, klapperten bis zu 3 Webstühle. ... Der Verdienst des Webers war karg und
betrug oft in einer Woche nicht viel mehr als 2 Gulden bei einer Arbeitszeit von oft 4 Uhr
morgens bis tief in die Nacht hinein mit einer kurzen Mittagspause und einer ebensolchen
abendlichen Feierstunde. ... Glücklich waren jene, die ein eigenes Häuschen und so viel Acker
besaßen, daß sie eine Kuh halten konnten, eigene Milch hatten und zum Bearbeiten des Ackers
keinen Bauer brauchten. ... Im allgemeinen waren die Weber bescheidene, anspruchslose
Menschen, die auf ihr Äußeres nicht vergaßen, immer sauber und an Sonn- und Feiertagen
festtäglich gekleidet. ... Zum Wirtshausgehen reichte zumeist das Einkommen nicht. Ihre
Naturverbundenheit bezeugte schon ein Blick von außen auf ihre Fenster, in denen es vom
Frühjahr bis zum Herbst blühte. ... An Wintersonntagen griffen sie auch gern zu einem Buch.
Viel gelesen wurde die Legende von der hl. Genovefa und Erzählungen aus den Büchlein der
Schülerbücherei, die sie dann miterlebten und bei sich ergebenden Gelegenheiten gern und mit
großer Treue wiedererzählten. ... Auch Gesang und Musik erfreute die Bewohner, besonders
die Weber. Sie sangen bei ihrer Arbeit und im frohen Beisammensein aus innerem Drange. Es
war dann der Gesang ein befreiendes Ausströmen der Gefühle, das auch den kunstlosesten
Gesang adelte. Bezeichnend für ihre Musikliebe war, daß die Musikkapelle des Ortes aus lauter
Webern bestand." [GT-02, S. 48-51]
Georg Tilscher erzählt realistisch vom Runarz zu Ende des 19. Jahrhunderts: "Auch im
Zeitalter der Industrialisierung ging in Runarz noch lange das Leben in der althergebrachten
Weise weiter. Der allgemeine Fortschritt bahnte sich nur langsam an. Im Landbau
verschwanden die Brachen und verminderte sich die Zahl der Flachsfelder. Der Siegeszug der
Baumwolle verdrängte langsam den Lein und förderte die Hausweberei. In den 70er und 80er
Jahren wurde fast in allen Häuschen, im Winter auch in Bauernhäusern, gewebert. Wo es der
Raum gestattete, klapperten bis zu 3 Webstühle. ... Der Verdienst des Webers war karg und
betrug oft in einer Woche nicht viel mehr als 2 Gulden bei einer Arbeitszeit von oft 4 Uhr
morgens bis tief in die Nacht hinein mit einer kurzen Mittagspause und einer ebensolchen
abendlichen Feierstunde. ... Glücklich waren jene, die ein eigenes Häuschen und so viel Acker
besaßen, daß sie eine Kuh halten konnten, eigene Milch hatten und zum Bearbeiten des Ackers
keinen Bauer brauchten. ... Im allgemeinen waren die Weber bescheidene, anspruchslose
Menschen, die auf ihr Äußeres nicht vergaßen, immer sauber und an Sonn- und Feiertagen
festtäglich gekleidet. ... Zum Wirtshausgehen reichte zumeist das Einkommen nicht. Ihre
Naturverbundenheit bezeugte schon ein Blick von außen auf ihre Fenster, in denen es vom
Frühjahr bis zum Herbst blühte. ... An Wintersonntagen griffen sie auch gern zu einem Buch.
Viel gelesen wurde die Legende von der hl. Genovefa und Erzählungen aus den Büchlein der
Schülerbücherei, die sie dann miterlebten und bei sich ergebenden Gelegenheiten gern und mit
großer Treue wiedererzählten. ... Auch Gesang und Musik erfreute die Bewohner, besonders
die Weber. Sie sangen bei ihrer Arbeit und im frohen Beisammensein aus innerem Drange. Es
war dann der Gesang ein befreiendes Ausströmen der Gefühle, das auch den kunstlosesten
Gesang adelte. Bezeichnend für ihre Musikliebe war, daß die Musikkapelle des Ortes aus lauter
Webern bestand." [GT-02, S. 48-51]
Auch andere Runarzer erinnern sich an bescheidene Verhältnisse: "Die Verkehrsverhältnisse von Runarz waren bis zum letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts sehr schlecht. Eine Änderung trat erst mit dem Bau der Mährischen Westbahn (Proßnitz-Triebitz) im Jahre 1890 ein. Sie verband die Orte der Großen Hanna mit jenen der Kleinen Hanna und kam bei Konitz der Sprachinsel am nächsten. Von Runarz führten nur Feldwege nach Konitz, denn die Straße von Konitz nach Ainsersdorf wurde erst im Jahre 1910 gebaut. Diese ungünstige Verkehrslage schränkte die Erwerbsmöglichkeiten ... ein. Wer keinen Bauernhof übernehmen konnte, der mußte Knecht, Waldarbeiter, Taglöhner, Maurer, Ziegelarbeiter, Hausweber, Schuhmacher oder Schneider werden, wenn er nicht eine Lehrstelle in Konitz erhielt. Nur wenigen Eltern war es möglich, dem Kinde ein Studium zu bezahlen. Wollte der Jugendliche trotz dieser Einschränkungen in eine bessere Stellung gelangen, möglichst beim Staate, dann blieb ihm nur der Weg über die verlängerte Militärdienstzeit offen." [RU-01, S. 32]
Ein neues Buch zu Runarz von Helga Sedlatschek [SE-01] enthält die Schulchronik und Porträts wichtiger Persönlichkeiten der Gemeinde.